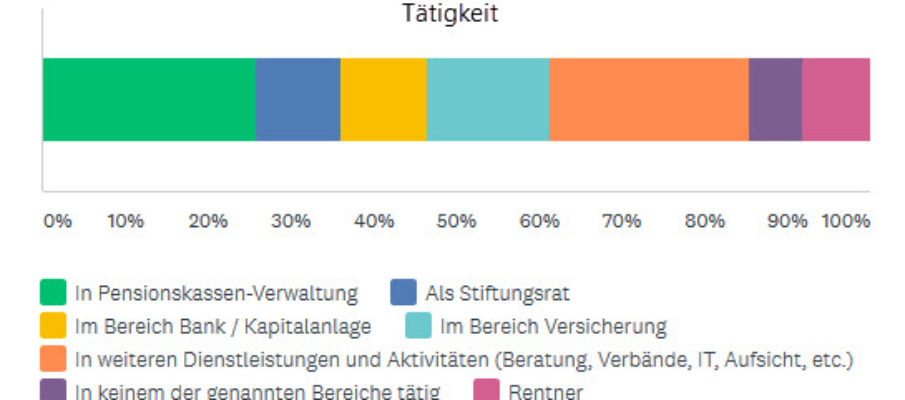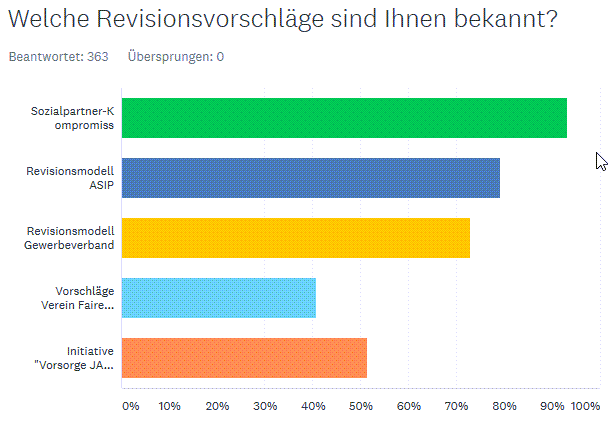Bundesbern hat derzeit andere Sorgen als die 2. Säule. Das verstehen wir. Dass der Bundesrat kurzerhand beschlossen hat, die Vernehmlassung zur BVG-Revision um zwei Monate zu verlängern, ist weniger nachvollziehbar. Der Entscheid kam vier Tage vor dem ursprünglichen Abschlusstermin. Die Stellungnahmen sind so gut wie überall geschrieben und per E-Mail verschickt. Es gibt vom Thema her keinen Grund, die Frist zu verlängern. Neue Einsichten und Überlegungen zu dieser Vorlage sind keine zu erwarten.
Da aktuell alles und jedes unter dem Blickwinkel des Virus zu sehen ist, wird das wohl auch hier der Fall sein. Aber das führt nicht weiter. Doch dem Bundesrat gibt es Gelegenheit, die ungeliebte Revision hinauszuschieben. Glanzvolle Auftritte vor ehrfürchtiger Presse sind bei diesem Geschäft nicht zu erwarten. Die Allmacht in Sachen Virusbekämpfung weicht dem politischem Alltag. Zur Debatte steht die Senkung einer versicherungstechnischen Grösse um ein paar Promille. Absehbar ist undankbare Knochenarbeit unter schwierigen Voraussetzungen, denn die Vernehmlassung ist nach heutigem Stand der Dinge für den Bundesrat ein Desaster.
Die Linke folgt in üblichem Kadavergehorsam dem missratenen Sozialpartnerkompromiss, auf der Rechten wurde der Arbeitgeberverband von wichtigen Mitgliedern, Parteien und den Fachverbänden im Stich gelassen. Letztlich keine Überraschung. Denn die vorgeschlagene Kompensationsmassnahme mit neuen Lohnprozenten ist so weit ab von aller liberaler Vernunft, dass man sich nur wundern kann, wie der Verband es fertigbringen konnte, sich in diese No-Go-Gefilde linker Umverteilungsträume zu verirren. Da fehlte es am nötigen politischen Spürsinn. Eigentlich ungewohnt, denn die Arbeitgeber kennen ja wohl ihre Pappenheimer, und zwar auf beiden Seiten des Jordan.
Dabei geht nicht nur um die politische Ausgangslage. Auch wenn die ausserordentlichen Umstände zum jetzigen Zeitpunkt irgendwann – hoffentlich bald – wieder einer Form von Normalität weichen, geben sie doch Anlass, die Vorlage unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit zu überprüfen.
Derzeit werden unzählige wirtschaftliche Existenzen gefährdet, wenn nicht zerstört, trotz Milliardenversprechen aus Bern. Besonders betroffen sind die Selbständigerwerbenden. Hier einige Fälle zur Auswahl:
Da ist der Restaurantpächter, dessen Betrieb gerade so viel abwirft, um Miete und sonstige Unkosten zu decken, aber nie den geringsten Spielraum gab, um Reserven zu bilden. Die vom Vermieter medial angekündigte Stundung (!) der Miete, nützt so gut wie gar nichts und ist mehr PR als Kulanz. Da wäre der Standbauer, der präzis nach Abschluss aller Vorarbeiten erfährt, dass die Messe abgesagt wird und nun mit Tonnen von Material dasitzt, die der Kunde nicht zu zahlen bereit ist, weil ihm ohne Messe der halbe Jahresumsatz flöten geht. Die Betreiberin des Nagelstudios, die schon mit den laufend sich ändernden Formularen der Arbeitslosenversicherung überfordert ist. Oder der Grafiker, dem jetzt die Kunden davonlaufen und der später noch schwerer zu Aufträgen kommt, weil dann noch mehr gespart wird. Er soll zwar auch ALV-Unterstützung bekommen, aber selbst der Maximalbetrag reicht nicht, um auch nur die ihm von der Kesb aufgebrummten Alimente zu bezahlen. Was jetzt?
Und auch viele Angestellte dürften unter der erwarteten Rezession mit drohendem Arbeitsplatzverluste leiden. Wohl dem, der jetzt in einem Grossbetrieb oder noch besser, viel besser, beim Staat seine Brötchen verdient. Nicht zu reden von den Rentnern, die finanziell ebenfalls nichts zu befürchten haben.
Unter diesen Umständen einen neuen Umverteilungsmechanismus per Giesskanne von Jung zu Alt, von den Erwerbstätigen zu den in Bälde Pensionierten mit alle ihren verbrieften Ansprüchen, wohlerworbenen Rechten und lebenslangen Garantien in Bewegung zu setzen, kann doch wohl nicht der Ernst eines Arbeitgeberverbands sein. Aber eine Meinungsänderung wurde bislang strikte vermieden. Ob man die Dinge in zwei Monaten anders sieht?
Gegenwärtig ist man bereit, jegliches Opfer für die Gesundheit vor allem der älteren Generation zu erbringen und dafür kaum abschätzbare wirtschaftliche Risiken in Kauf zu nehmen. Damit ist wohl das maximal vertretbare Mass an Solidarität zwischen den Generationen oder genauer von Jung zu Alt mehr als erreicht.
Eine BVG-Reform, die ihren Namen verdient und mehr sein soll als das vorsichtige Drehen an ein paar Schräubchen, muss erstens die Basis für eine langfristige Stabilisierung anstreben und zweitens ein neues Gleichgewicht zwischen Aktiven und Rentnern schaffen. Davon ist die Vorlage weit entfernt. Sie hatte, wie übrigens die diversen Alternativen auch, nie diesen Anspruch. Zwei Monate längere Vernehmlassungsfrist sind unter den aktuellen Umständen nicht mehr als ein Ausweichmanöver. Eigentlich muss es für die Revision heissen: Zurück auf Feld eins.